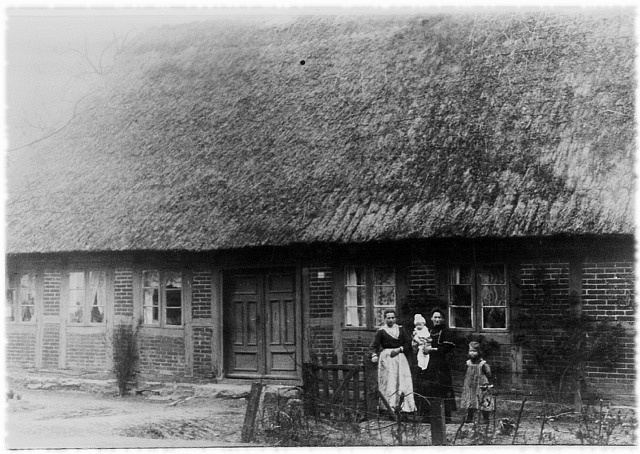 Abb.: Die Kate
Westenhofen in der Richthofenstraße.
Abb.: Die Kate
Westenhofen in der Richthofenstraße.Im Jahr 1679 verschenkte der Dänische König Christian V. das
Gut Seekamp, zu dem auch das Bauerndorf Holtenau gehörte, an seinen
Oberjägermeister von Hahn wegen geleisteter treuer Dienste, wobei
das Festungsgebiet von Christianspries
von dieser Schenkung ausdrücklich ausgenommen war. Der Dänische
König hatte das Gut Seekamp ursprünglich wegen des Baus der
Festung Friedrichsort in seinen Besitz genommen.
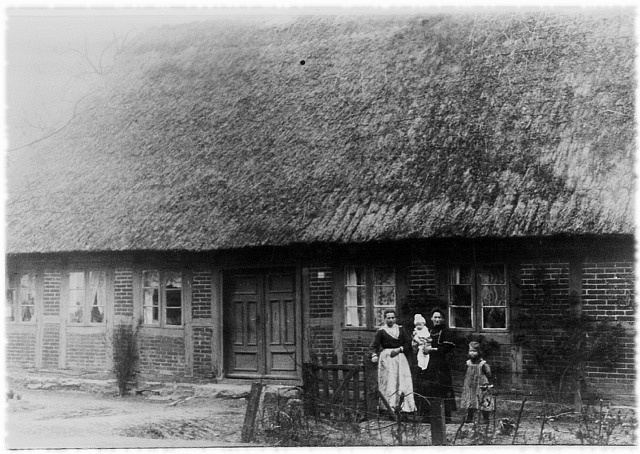 Abb.: Die Kate
Westenhofen in der Richthofenstraße.
Abb.: Die Kate
Westenhofen in der Richthofenstraße.
In der Urkunde über die Schenkung des dänischen Königs Christian V. an den Ober-jägermeister Hahn aus dem Jahre 1679 ist folgendes zu lesen:
Wir Christian V. von Gottes Gnaden König zu Dänemark, tun kund hiermit für uns und unsere königlichen Erbnachfolger, dass wir dem wohlgeborenen, unseren Geheimbten Rat, Oberjägermeister und lieben Getreuen, Herrn Vincenc Joachim Hahn zu Jägerspreiss und seinen Erben wegen seiner Uns geleisteten getreuen Dienste und aus besonderen königlichen Gnaden allergnädigst dorniert und geschenkt unser im Herzogtum Schleswig gelegenes Gut Seekamp, nebst dem Meierhof Holtna mit allen dazugehörigen Untertanen, Äckern, Wiesen, Weiden, Hölzungen, Fischereien, Hoch- und Niedrigjagden, Hoch und Niedergericht an Hals und Hand, auch mit allen anderen frei und Gerechtigkeiten, das er solches allsofort in Besitz nehmen, dasselbe zu seinem und seiner Erben Nutzen, Besten und Frommen auf was Weise solches Geschehen könne, geniessen und gebrauchen möge.
Wie dieses Zitat deutlich macht, ging es bei dieser Schenkung
nicht nur um das tote Inventar und die Tiere, sondern auch um die
Bewohner Holtenaus, die zum größten Teil Leibeigene
waren. Die Leibeigenschaft entstand parallel zur Entwicklung der
Gutsherrschaft und bereits um 1500 herum befanden sich viele gutsuntertänige
Bauern in einem Abhängigkeits-verhältnis zu ihrem Gutsherren, daß
der späteren Leibeigenschaft sehr nahe kam.
Die adeligen Güter waren zu Großversorgern für die sie umgebenen Gebiete und Städte geworden und hatten neben einer hohen volkswirtschaftlichen auch eine kulturelle Bedeutung erlangt. Die Gutsherren waren so zu hohem Ansehen gelangt und besaßen eine eigene Gerichtsbarkeit. Die Landbevölkerung, die dem Gut unterstellt und enteignet war, versank dagegen immer mehr in einen Zustand völliger Hörigkeit.
Ihre rechtliche Grundlage erhielt die Leibeigenschaft im Jahre
1524, als der Deutsche Kaiser Friedrich I. der Ritterschaft als
Besitzer der Güter die Hand- und Halsgerichtsbarkeit
über ihre Untertanen zusprach. Dieses Rechtsprivileg nutzten die
Gutsherren, indem sie ihren Untertanen immer mehr Dienste (Frondienste
)
abverlangen während sie gleichzeitig ihre Güter in agrarische
Großbetriebe umwandelten. Die Produktionsverhältnisse wurden daher
von der ursprünglichen Acker-Getreide-Wirtschaft auf eine
Weide-Meierei-Wirtschaft umgestellt, was viele Arbeitskräfte auf
den Dörfern überflüssig machte.
Dazu trennten die Gutsbesitzer ihr Hofland
vom Bauernland
ab und zogen nicht bewirt-schaftetes – wüstes
–
Bauernland ein, das es u. a. als Folge von Kriegen und Seuchen
reichlich gab. Teilweise legten die Gutsherren aber auch selber
ganze Bauerndörfer nieder – das so genannte Bauernlegen
.
Das Niederlegen von Bauerndörfern ist zwar nicht im Gutsbezirk Seekamp vorgekommen, wohl aber im Bereich des Gutes Bülk. Begünstigt wurde die ökonomische Entwicklung der Güter durch steigende Preise für landwirtschaftliche Produkte. Bei Produkten wie Roggen, Ochsen und Butter kam es zwischen 1500 und 1600 zu einer Vervierfachung des Preises.
Die Leibeigenschaft wurde 1614 auf dem Haderslebener Landtag als
gültiger Rechtszustand anerkannt. Verbunden war dies mit der
Aufforderung an die Gutsherren, … sich christlich und
rechtsmäßig zu verhalten, so daß eine Flucht nicht
erforderlich sei
. Schließlich befand sich ca. 1
Sechstel der Bevölkerung Schleswig-Holsteins im Zustand der
Leibeigenschaft.
Die Leibeigenen hatten keinen Besitz an dem Land, das sie
bewirtschafteten, und dem Hof, den sie bewohnten. Sie waren dazu
verpflichtet gegenüber ihrem Herren Dienste zu leisten und
zugleich war es ihnen untersagt, wegzuziehen (das so genannte Schollenband
).
Die Kettung der Menschen an das Land war wiederum eine direkte
Folge der Niederlegung der Bauerndörfer, denn diese führte über
längere Sicht zu einem allgemeinen Mangel und auch zu einem Mangel
von Arbeitskräften.
Das bisherige Besitzrecht der Bauern wurde zu einem bloßen Nutzungsrecht, das jederzeit gekündigt werden konnte, aus "Erbpächtern" wurden "Leibeigene ohne Recht an ihren Äckern". Die Freizügigkeit wurde stark eingeschränkt, für das ihnen übertragene Land mußten die Gutsuntertanen "ungemessene" Dienste leisten. Der Gutsherr wurde auch zum Gerichtsherren mit Polizeigewalt.
Dem Gutsherren stand es auch zu, die Heiratserlaubnis zu erteilen
oder zu verweigern, was ihm die Möglichkeit an die Hand gab, die
Bevölkerungszahl innerhalb seines Einflußbereiches zu steuern und
damit seinen Profit zu sichern (Heiratskonsens
).
Die Beziehung zwischen Leibeigenen und Gutsherren war jedoch
nicht nur einseitig, denn auch der Gutsherr hatte gewisse
Verpflichtungen einzuhalten wie beispielsweise für den Schutz
seiner Leibeigenen zu sorgen oder ihnen in Notzeiten beizustehen –
dies konnte beispielsweise durch die Lieferung von Saatgetreide,
Baumaterial oder Vieh geschehen (Konservationspflicht
).
Kam es durch Kriegswirren zu Hungersnöten, hatten die Dorfbewohner
das Recht, sich auf dem Gutshof beköstigen zu lassen. Eine weitere
Pflicht des Gutsherren gegenüber seinen Untertanen war das Gnadenbrot
,
das alten, arbeitsunfähigen Leibeigenen ohne Familie bis zu ihrem
Lebensende gewährt wurde. Alleine schon aus diesen Gründen war die
Steuerung der Bevölkerungsentwicklung durch den Gutsbesitzer so
wichtig.
Im Jahr 1741, also ein halbes Jahrhundert vor Aufhebung der Leibeigenschaft, wohnten in Holtenau insgesamt 131 Menschen, von denen 108 leibeigene und 23 freie Personen waren:
Bei jedem Wechsel ihres Herren – z. B. durch Tod oder Verkauf –
mußten die Leibeigenen ihre persönliche Bindung an den neuen
Herren durch die Ablegung eines Leibeigeneneides bekräftigen. So
wurden beispielsweise am 2. November 1741 die Holtenauer
Untertanen nach Gut Seekamp bestellt um ihren Eid abzulegen, daß
sie das … was mir in der Herrschaft Namen anbefohlen
werden wird, jeder Zeit getreu und fleißig und ohne einzige
Gegenrede verrichten …
werden.
Folgender Eid wurde von den Holtenauer Untertanen abgeleistet:
|
“Ich, N.N., leibeigener Untertan des Gutes Seekamp, gelobe und schwöre zu Gott und auf das heilige Evangelium einen körperlichen Eid, dass demnach die hochgeborene Frau, Frau Ernestina, geborene von Gabel, verwitwete Gräfin von Schack-Schackenburg, in Vormundschaft des Herrn Sohnes, Herrn Hans Schack, Grafen zu Schackenburg, nunmehro unsere ordentliche Obrigkeit geworden, hochgedachter Frau Gräfin und dem Herrn Sohn, wie auch den Erben getreu, hold und gehorsam sein, der gnädigsten Herrschaft und des ganzen Gutes Bestes, so viel an mir ist, befördern, hingegen Schaden und Nachteil bestmöglichst verhüten und hintertreiben, was mir in der Herrschaft Namen anbefohlen werden wird, jeder Zeit getreu und fleissig und ohne einzige Gegenrede verrichten, den mir vorgesetzten Verwaltern und Vögten allen Gehorsam bezeigen, aus dem Gute Seekamp ohne der gnädigsten Herrschaft Vorbewusst und Einwilligung nicht weichhaft werden, sondern nebst deren Meinen beständig darinnen verbleiben und ehe wir dieses unsers Eidschwurs und Pflichten erlassen, keine anderen Herrschaften annehmen, auch sonsten bei allen und jeden Begebenheiten uns dergestalt aufführen und bezeigen wollen, wie es die Pflicht und Schuldigkeit eines ehrliebenden und getreuen leibeigenen Untertanen erfordert und mit sich bringt. So wahr mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium.” |
Dazu gehörten:
sowie:
Die anderen Bewohner Holtenaus waren gegenüber der Gutsherrschaft
zu unterschiedlichsten Diensten verpflichtet. Die Dienstpflicht
eines Leibeigenen begann mit dem 6. Lebensjahr und dem Hüten des
Viehes; mit 12 Jahren wurde er Ackerjunge
oder so
genannter Fünfter Mann
; mit 15 konnte er Großjunge
oder Vierter Mann
werden. Bis zum 20. oder 22.
Lebensjahr konnte der Leibeigene Kleinknecht
oder
Dritter Mann
werden und mit 24 bis 25 Jahren zum
Großknecht” aufsteigen. Der Dienst für den Gutsherren wurde im
Sommer morgens um 5 Uhr und im Winter morgens um 7 Uhr angetreten.
Der ehemalige Holtenauer Lehrer Kurt Petersen beschreibt exemplarisch für den Holtenauer Vollhufner Hinrich Horn, der gleichzeitig der Bauernvogt war, die materiellen Verhältnisse eines Holtenauer Vollhufners:
Die Hofstelle bestand aus einem 36 Fuß langen und 38 Fuß breiten Haus, einer 36 Fuß langen und 28 Fuß breiten Scheune, sowie einer zur Hofstelle gehörenden 43 Fuß langen und 14 Fuß breiten Kate. Dazu kamen an lebenden Inventar 13 Pferde, 2 Füllen, 7 Kühe, 8 Stück Jungvieh, 10 Schafe, 4 Schweine und 6 Gänse. Von diesen Tieren war jedoch nach Ende des Vertrages der größte Teil wieder an den Gutsherrn abzuliefern. Dazu kam noch totes Inventar wie Wagen, Pflug und Egge, Pferdegeschirr bis hin zu Töpfen und Pfannen, so daß einem Hufner als persönliches Eigentum nur wenige Dinge wie Bett und Stuhl und Kleidung blieben.
Die von den Holtenauer Untertanen zu erbringenden Dienstleistungen wurden im Jahre 1769 geändert und es steht daher in den damaligen Aufzeichnungen über die Holtenauer folgendes zu lesen:
|
“Die 4 Köthener, welche ansonsten das Mitlöpen getan
haben, leisten ein jeder im Jahr 35 Tage Hofdienst,
bezahlen überdies ihre Heuer, auf Neujahr fällig, jeder
20 Taler. Die Insten, soviel deren sich finden, muß
jeder den Sommer über wöchentlich 2 Tage Arbeit tun.
Weilen der Garten verwildert, haben die Insten zum Teil
solche Gartentage mit Spinnen begütigt, 10 Pfund Flachs
oder 14 Pfund Hede aus freiem Willen, ohne eine
Gerechtigkeit daraus zu machen. Wenn des Sommers Korn
eingefahren wird, müssen alle Insten ohne Unterschied
einen Menschen in die Scheune geben, das Korn
aufzustaken. |
Der Besitzer des Holtenauer Dorfkruges gehörte zu den so
genannten Heuersleuten
, daß heißt jenen Personen,
die zwar keine Leibeigenen waren, jedoch eine Grundheuer
an den Gutsbesitzer zu zahlen hatten und nur in Ausnahmefällen zu
Hofdiensten herangezogen werden durften. Neben dem Holtenauer Dorfkrug erwähnt Nicolaus
Detlefsen noch eine Krügerei in Dickmissen (Schusterkrug). Im Dorf
gab es – wie auch in Pries und Schilksee
– ein Dorfhirtenhaus, das durch die Dorfbewohner unterhalten
werden mußte.
Nach mehreren Besitzerwechseln kam das Gut Seekamp schließlich in den Besitz des Grafen Hans von Schack-Schackenburg (eher wohl Frederik Christian Schack *1736; †1790) mit Stammsitz auf Møgeltønder. Bereits im Jahre 1786 war ein Ersuchen an den Dänischen König ergangen, die Leibeigenschaft aufzuheben. Ein Jahr vor seinem Tod und noch vor Ausbruch der Französischen Revolution gab Schack in einem vorläufigen Vertrag mit den Bauern die Leibeigenschaft für alle Dörfer im Gutsbezirk Seekamp auf — in Kraft trat der Vertrag zum 1. Mai 1791.
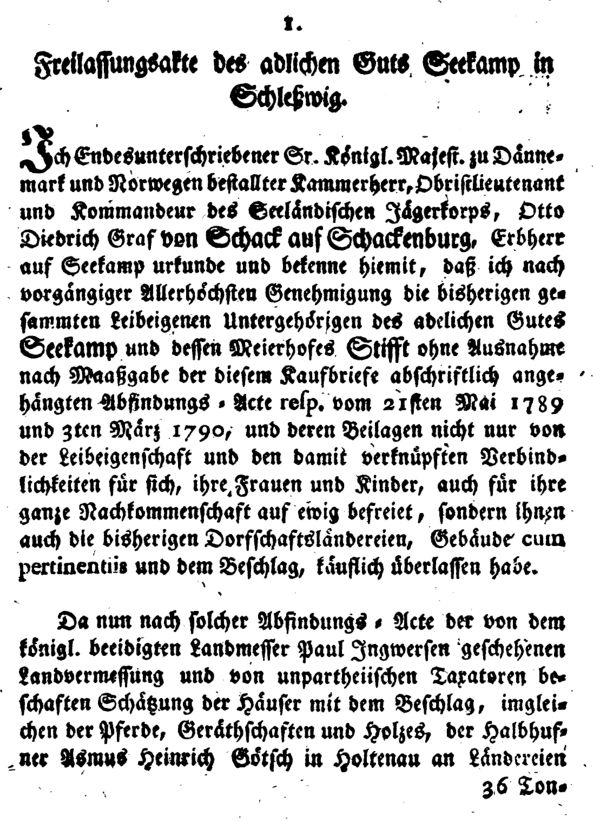 Abb.:
Freilassungsakte.
Abb.:
Freilassungsakte.
Überlegungen, einen Teil des Seekamper Hoflandes zu parzellieren
und die Bauern zu Eigentümern ihrer Höfe zu machen, gab es zwar
bereits seit 1787, nur wurde die Umsetzung durch die besondere
Rechtsform, in der das Gut Seekamp stand, erschwert. Denn Seekamp
war ein so genanntes Fideikommißgut
1
und wäre zudem aufgrund des Schenkungsvertrages von 1679 bei
Fehlen männlicher oder weiblicher Erben wieder an den dänischen
König zurück gefallen.
Der König verlangte einen genauen Zergliederungsplan für das Gut, das daher zuerst einmal genau vermessen werden mußte. Gleichzeitig wurde eine genaue Rentabilitätsberechnung durchgeführt, die zu dem Ergebnis kam, daß eine Durchführung der Parzellierung zu einer Rentabilitässteigerung von 80% (!) führen würde. Die endgültige Genehmigung des dänischen Königs erfolgte dann am 8. September 1790.
Nicht nur die Impulse der Aufklärung, auch rein ökonomische Aspekte leiteten daher das Ende der überkommenden Wirtschaftsform ein. Das enge Korsett, in das die Leibeigenschaft die Agrarwirtschaft preßte, verhinderte jede Verbesserung der wirtschaftlichen als auch der sozialen Situation auf dem Lande. So machte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht nur in der dänischen Staatsregierung, sondern auch unter vielen Gutsbesitzern die Überzeugung breit, daß es auch in ihrem eigenen Interesse war, die überkommenen Verhältnisse grundlegend zu ändern.
Dabei waren die Gründe für die Aufhebung der Leibeigenschaft vor
allem wirtschaftlichen und strukturellen Veränderungen in der
Landwirtschaft geschuldet. Die Gutsbesitzer hatten zur
Verbesserung der Milchwirtschaft Holländer auf ihre Güter geholt,
die die Milchwirtschaft völlig neu organisierten. Die Holländer
errichteten eigene Meiereien2, die so genannten
Holländereien
, für die sie Pacht an den Gutsherrn
entrichteten. Diese Entwicklung verbunden mit einem größeren
Geburtenüberschuß führten auf den Gütern zu einer Verknap-pung von
Arbeit.
Daß sich die Rentabilität der Landwirtschaft steigern ließ, hatte bereits im Jahre 1739 Hans Rantzau auf Gut Ascheberg bewiesen, der Söhne seiner leibeigenen Bauern auf Teilen seines Hoflandes als Pächter ansiedelte und damit die Rentabilität des Gutes verbessern konnte.
1768 wurde in Gottorf die Schleswig-Holsteinische
Landcommission
gegründet, deren Aufgabe es war, die
staatlichen Domänen zu parzellieren. Im gleichen Zuge wurden die
leibeigenen Bauern vom Hofdienst und dem Schollenband befreit und
ihnen die Möglichkeit geboten die Höfe zu kaufen.
Auf den Gütern Noer, Grönwohld und Dänisch-Nienhof endete die
Leibeigenschaft bereits um 1760 und 1770. 1786 wurden die
Leibeigenen des Gutes Eckhof frei. Erst zum 1.1.1805 wurde durch
den Dänischen König Christian VII. die Leibeigenschaft in ganz
Schleswig-Holstein im Zuge der Agrarreform
aufgehoben.
Alle Holtenauer Hufner, Kätner, Insten und deren Familien wurden
durch den Vertrag von der Leibeigenschaft und ihren
Verbindlichkeiten auf ewig
befreit. Es wurde im
Vertrag unter anderem die Parzellierung der Ländereien geregelt.
Die Hoffelder des Gutes kamen an den Meierhof
Stift, 260 Quadratruten ehemaliger Gutsländereien gingen an
die Holtenauer, wobei es sich um die folgenden Gebiete handelte:
Heisch, Scheidekoppel, Kahlenberg, Muschelkate,
Schusterkrug, Dreikronen, Voßbrook, Diekmissen, Kiekut und
Fischerkate. Weiterhin wurde den Holtenauern ihr Schulhaus unentgeltlich überlassen, der
Schulmeister mußte von den Holtenauern aber fortan selbst bezahlt
werden – das Recht, den Schulmeister zu ernennen, behielt sich der
Gutsherr jedoch weiterhin vor. Weiterhin mußten die Bauern eigene
Armenkommunen bilden, da das bislang durch die Gutsherrschaft
sichergestellte Gnadenbrot
fortan fortfiel.
Der §1 besagt, daß die Abmachungen nur dann Gültigkeit haben, wenn der Parzellenverkauf zustande kommt. Es handelt sich um Hof Seekamp, Heisch, Scheidekoppel, Kahlenberg, Dreikronen, Friedrichsruh, Krabbenhöff und die Wassermühle in Dänischenhagen.
In der Akte über die Abfindung der Seekamper leibeigenen Gutsuntertanen findet sich folgendes:
|
“§2) Unter dieser wesentlichen Voraussetzung ist nun zuvörderst der gräflichen Gutsherrschaft gnädiges Versprechen, dass die sämtlichen leibeigenen Gutsangehgörigen auf Seekamp und dem Meierhof Stift, sie seien Hufner, Kätner, Insten oder wie sonsten genannt worden, von der Leibeigenschaft und den damit verknüpften Verbindlichkeiten für sich und ihre Frauen und Kinder, auch für ihre ganze Nachkommenschaft auf ewig befreit sein sollen. §3) 1. Die 4 vollen und 2 halben Hufner in Holtenau sollen diejenigen Ländereien, die sie bisher besessen und genutzet, eigentümlich behalten. 2. Erhalten sie die Gebäude, die jeder schon besitzt, mit der dabei befindlichen Abschiedskate und die zur ganzen Dorfschaft gehörigen Hirtenkate. 3. Überkömmt eine jede volle Hufe an Beschlag 4 Pferde und an Hornvieh, Schafen und Schweinen und Federvieh alles, was gegenwärtig ist, zum angemessenen Kaufschilling. 4. Bäume, Gesträuch und Gebüsch reserviert sich die Gutsherrschaft. §4) Die Dorfschaft Holtenau bezahlt einen jährlichen
Kanon von 1 Taler 32 Schilling für die Tonne Land.” |
Zur Zeit der Aufhebung der Leibeigenschaft bestand das Dorf
Holtenau wieder aus 4 Vollhufen, 2 Halbhufen, 4 großen Katen und
mehreren kleinen Katen- und Instenstellen und hatte eine Größe von
ca. 360 Hektar. Die 4 Holtenauer Vollhufner erhielten je 73 Tonnen
55 Ruten Land, die beiden Halbhufner je 36 Tonnen 162 Ruten 2,5
Fuß, die 4 Viertelhufner je 20 Tonnen. Die Hufner erhielten auch
die von ihnen bisher genutzten Wohn- und Wirtschaftsgebäude, dazu
lebendes und totes Inventar entsprechend der Größe der
Bauernstelle. Der Wert wurde geschätzt und mußte in Form des so
genannten Kaufschilling
entrichtet werden, der
300 bis 500 Reichstalern entsprach, jedoch nicht sofort in bar
bezahlt werden mußte. Weiterhin wurden die Armenversorgung, die
Verteilung von Kirchenleistungen und Kirchenstühlen, die Kosten
für Polizeidienste und die medizinische Versorgung geregelt.
Da jeder, der sich drei Jahre lang im Seekamper Gutsbezirk
aufgehalten hatte, dadurch ein Heimat- und Armenrecht erwarb,
wurde die Einreise bedürftiger Fremder genau überwacht. So wurde
1823 am Schusterkrug eine
Armenkate errichtet, die den Namen Donaschloß
erhielt.
Nachdem die Bauern von der Leibeigenschaft befreit worden waren, konnten sie das bereits von ihnen bewirtschaftete Land, die Gebäude und anderes lebendes oder totes Inventar kaufen. Für die Holtenauer Voll- und Halbhufner wurden folgende Summen veranschlagt:3
Tabelle: Belastungen der Holtenauer Vollhufner (VH) und Halbhufner (HH) nach der Aufhebung der Leibeigenschaft und der Parzellierung.
|
Die Hirtenkate, die sich auf dem Holtenauer Gebiet befand, wurde so aufgeteilt, daß die Halbhufner nur die Hälfte des Preises der Vollhufner zu zahlen hatten.
Als auf der Hofstelle Horn der Besitz von Friedrich Horn auf den letzten Leibeigenen Otto Hinrich Bandholt übergeben wurde bestand dieser außer dem Hofgebäude und Inventar aus folgenden Tieren, die jedoch zum größten Teil der Gutsherrschaft gehörten (in Klammern): 13 Pferde (12), 2 Füllen (2), 7 Kühe (4), 8 Starken (3), 10 Schafe (6), 4 Schweine (2), 6 Gänse (6). Die Aufhebung der Leibeigenschaft und damit der Wegfall der Spanndienste führte dazu, daß sich Bauer Bandholt als Freier nur noch 4 anstatt der bisher 13 Pferde hielt.
Folgendes Inventar ging in den Besitz Bandholts über:
1 beschlagener Wagen mit Leitern, 2 Blockwagen mit Fleeken, 2 Paar Leitern, 1 großer Schlitten, 1 Pflug, 8 Eggen, 5 Pferdegeschirre, 1 Halskoppel, 2 Äxte, 3 Beile, 1 Hack und Queck, 2 Spaten, 5 Bohrer, 2 Durchschläge, 1 Säge, 1 eiserner Keil, 1 eiserne Kette, 1 Schneidbank mit Messer, 3 Heuforken, 4 Mistforken, 1 Misthaken, 1 Häcksellade mit Messer, 1 Biertonne, 1 Büktonne, 1 Scheffel und Schaufel, 1 Backtrog, 1 DreschWegel, 4 Sensen, 3 Siebe, 2 Schwingfüße, 6 Vorder- und Hinterreepen, 10 Säcke, 5 Kessel, 2 Grapen, 1 Butterfaß und 4 Holzkübel für Milch, 2 Wasser- und 1 Milcheimer, 1 Kohlstoßer mit Block, 1 Kesselhaken und Feuerzange, 8 Stühle, 1 Tisch, 1 Salzbütte, 1 Dracht und 1 Drankkübel, 1 Dachstuhl und 1 loses Schapp, 3 Betten mit Laken.
Nachdem 1788 das von den Holtenauer Leibeigenen gemeinsam
bewirtschaftete Land vermessen und in fest begrenzte Flächen
aufgeteilt worden war, konnte Otto Hinrich Bandholt zum 1. Mai
1791 ca. 40 ha Land übernehmen, für das er einmal jährlich im Mai
eine Abgabe von 121 Reichstalern zu leisten hatte – den so
genannten Canon
.
Jedem Holtenauer Hufner und Halbhufner wurden als unentgeltliche Dienste für den Gutsherrn zudem noch eine jährliche Fuhre nach Kiel oder stattdessen zwei Fuhren nach Holtenau zur Verschiffung sowie allen gemeinsam das Heranfahren des Holzes aus den guts-herrlichen Forsten zum Stammhof und zum Pastorat auferlegt.
Viele Dinge des täglichen Lebens wurden im Vertrag bis ins Kleinste geregelt wie zum Beispiel die Verfügung über die Jagd und die sich dadurch ergebenden Schäden im Kornwuchs auf den bäuerlichen Feldern, die Verfügung über das Gebüsch und die Sträucher oder die auf den Feldern stehenden Bäume, die die Bauern dem Gutsherrn nach voriger Schätzung ihres Wertes abkaufen konnten. Weiterhin wurden die Bauern dazu verpflichtet, die bisher durch das Gut benutze Getreidemühle weiterhin zu beliefern oder aber für den Fall, daß der Gutsherr selbst eine Mühle bauen würde, dort ihr Korn mahlen zu lassen.
Jedem Hufner wurde die in Zukunft durch ihn zu unterhaltende Wegstrecke zugewiesen, wobei in dem Fall, daß sich auf der einen Seite des Weges Parzellenland und auf der anderen Seite das Land des Hufners befand, der betreffende Parzellist und der Hufner jeweils ihre Seite des Weges zu unterhalten hatten. Im Falle jedoch, daß auf der einen Seite des Weges Stammhofländereien lagen, hatte der Hufner die gesamte Strecke alleine zu unterhalten. Dieses Verfahren galt auch für die Unterhaltung der Befriedungen direkt aneinander grenzender Koppeln, sofern diese nur durch einen Erdwall von einander getrennt wurden.
Es war den Hufnern auch verboten, die sich auf ihrem Land befindlichen Wasserläufe oder stehenden Gewässer zu verändern und Umleitungen, Stauungen oder Dämmungen zu Lasten anderer zu errichten.
Der Gutsherr blieb auch nach dem Ende der Leibeigenschaft Richter über die Bewohner des Gutsbezirks, der auch nach dem Ende des Adelsgutes Seekamp weiter bestand. Seit 1805 hatte er aber die Gerichtsbarkeit durch einen Justitiar auszuüben, der alle vier Wochen Gerichts-sitzungen über Zivil- und Strafrechtssachen auf dem Stammhof Stift abhielt. Ein kellerartiger Raum mit zwei Fenstern diente dort auch als Gefängnis. Das Gefängnis für den Gutsbezirk Knoop befand sich auf dem “Hof Busch” im Lummerbruch. Dort gab es sowohl auf dem Dachboden als auch im Keller Gefängniszellen.
Nur der Meierhof Stift, dessen Land das ertragreichere war, blieb bis 1905 im Besitz der Familie Schack-Schackenburg und wurde Stammhof. Zudem besaß Stift große Waldflächen, die man so zu schützen gedachte, da es sich bei Parzellierungen auf anderen Gütern gezeigt hatte, daß die zukünftigen Besitzer der Bauernstellen den Kaufpreis oft durch rücksichtslosen Holzeinschlag und -verkauf erzielt hatten, was auf Kosten einer nachhaltigen Bewirtschaftung ging.
Im Jahre 1876 wurde der Gutsbezirk Seekamp aufgelöst und es entstanden die drei Land-gemeinden Holtenau, Pries und Schilksee. 1887 verkaufte die Familie Schack das Fördeufer zwischen der Kanalmündung und Friedrichsort an die kaiserliche Marine. Zur damaligen Zeit befand sich auch noch die alte Schmiede und das sie umgebende 6 ha Land noch im Besitz der Familie Schack.
Während die Zeit der adeligen Güter im 19. Jahrhundert ihrem Ende
entgegen ging, brachte die neu gewonnene Freiheit den Bauern einen
wachsenden Wohlstand. Der Kaufpreis der Ländereien war so günstig
gewesen, daß viele Bauern diesen bereits nach wenigen Jahren
abgetragen hatten. Günstig auf die landwirtschaftliche Entwicklung
wirkten sich die Nähe der Festung
Friedrichsort, der Stadt Kiel und des Eiderkanals
aus, wo nicht nur landwirtschaftliche Produkte abgesetzt werden
konnten. Gerade die Holtenauer Bauern verdienten sich ein gutes
Zubrot mit dem Treideln
der Schiffe, so … daß sie mit der Leibeigenschaft zugleich
die damalige höchst frugale Lebensweise ablegten und nur zu
schnell an einen ihnen bisher völlig fremd gebliebenen Luxus
gewöhnten
.
Das Zentrum des Holtenauer Bauerndorfes blieb weiterhin die Dorfstraße, die heutige Richthofenstraße, die zur damaligen Zeit noch ungepflastert war. Im Sommer sehr staubig und in der nassen Jahreszeit tief aufgeweicht blieben hier die Fuhrwerke immer wieder im Morast stecken. Dazu kam die starke Verschmutzung durch das Kuhtreiben im Herbst.
Die Freiheit als persönliche Unabhängigkeit war gewonnen, aber sie hatte auch ihren wirtschaftlichen Preis, zumal die Bedingungen so festgelegt waren, daß sich - das galt wohl allgemein - der Gutsbesitzer wirtschaftlich wesentlich besser stand als vorher. Seit Generationen gewohnt, in Abhängigkeit, aber auch unter materieller und geistiger Fürsorge des Gutsherrn zu leben, fiel es manchem ehemals Leibeigenen schwer, jetzt als freier Bauer für sich, jedoch noch schwerer als bisher zu arbeiten und selbst zu entscheiden zu müssen, um aus dem möglichen Fortschritt einen wirklichen werden zu lassen.4
Einige der ersten Hufner im Gutsbezirk Seekamp hatten ihre Ländereien kurz nach der Parzellierung an wohlhabende junge Landleute aus der Probstei verkauft, die den dortigen aufwendigen Lebensstil auch im Seekamper Gutsbezirk einführten. Nicht wenige dieser neuen Besitzer waren nach kurzer Zeit bankrott, nicht zuletzt infolge verschärfter Versteuerung aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage des dänischen Gesamtstaates.
Auch die Folgen der Napoleonischen Kriege trafen die Landwirtschaft im Dänischen Wohld schwer, insbesondere der Durchzug gegnerischer Truppen um die Jahreswende 1813/14, dazu kam ein englischer Einfuhrstopp für Vieh und Getreide.
So mußte mancher Landwirt seinen Besitz verkaufen oder Bankrott
anmelden, während die Kätner oder Insten Not litten. So änderte
sich im Grunde nicht viel an den Verhältnissen, auch wenn sich die
wirtschaftliche Lage vieler Bauern im Vergleich zu früher
verbessert hatte. Trotzdem wirkte das Verhältnis Herr
zu Knecht
noch lange nach – und sei es nur im
Umgang miteinander, denn auch … nach Aufhebung der
Leibeigenschaft zeigte die Landbevölkerung noch lange das
altgewohnte, devote Verhalten gegenüber den Gutsherren, die
doch nicht mehr Herren waren. Nach wie vor hielt man
bescheiden vor ihnen die Mütze in der Hand obwohl das
Verhältnis wesentlich besser und persönlicher geworden war.
© Bert Morio 2017 — Zuletzt geändert: 12-10-2017 18:02
In der deutschen Rechtsprechung bezeichnete der (Familien-)Fideikommiss, auch Fideikommiß geschrieben, unveräußerliches Vermögen, das nach der Verfügung des Stifters sich immer in der Familie forterben soll und nicht verkauft werden darf. Der Begriff wurde auch für Regelungen verwendet, das Vermögen eines Adelsgeschlechts generationenübergreifend und ungeteilt zu übertragen. Zu diesem Zweck konnte eine Stiftung gegründet und eine Erbfolge festgelegt werden. Durch diese Regelung wurde verhindert, daß das Vermögen und insbesondere das Stammgut zersplittert wurden. ↩
Siehe auch der Holtenauer Meierhof und der Meierhof Stift. ↩
N. Detlefsen, S. 79. ↩
Giertz, Walter: Ende der Leibeigenschaft, Holtenauer Hefte, Informationsheft 2, Kiel 1991, S. 13. ↩