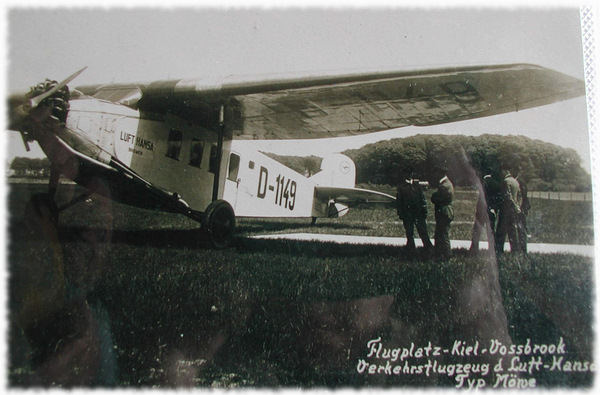 Abb.: Auf dem Holtenauer Flugplatz, der auch als
Abb.: Auf dem Holtenauer Flugplatz, der auch als Flughafen Kiel-Voßbrookbezeichnet wurde, im Hintergrund der Wald Voßbrook.
Viele Holtenauer Straßennamen mit bekannten Namen aus der
Luftfahrt wie die Richthofen-, Lilienthal- oder Immelmannstraße
zeigen die besondere Bedeutung, die der Flughafen Holtenau für die
Entwicklung des Stadtteils hatte. Ist vom Holtenauer Flugplatz
die Rede, dann ist immer zu bedenken, daß es in Holtenau sowohl
einen See- als auch einen Landflugplatz gibt; teilweise wird für
den Landflugplatz auch vom Fliegerhorst Holtenau
gesprochen. Die Eingliederung der Marineflieger
in die Befehlsstruktur der Luftwaffe im Dritten
Reich tat ihr Übriges.
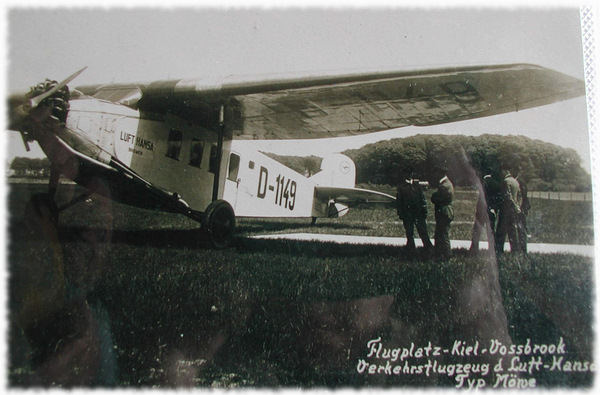 Abb.: Auf dem Holtenauer Flugplatz, der auch als
Abb.: Auf dem Holtenauer Flugplatz, der auch als Flughafen
Kiel-Voßbrook
bezeichnet wurde, im Hintergrund der Wald Voßbrook.
Bereits 1914 wurden die Marineflieger
(zur Zeit des Kaiserreiches auch Seeflieger
genannt) von Danzig nach Kiel verlegt. Der Marineflugplatz befand
sich seit 1913 auf der Halbinsel Voßbrook,
einem Gelände, das aus dem Aushub des Kanalbaus
aufgeschüttet wurde.
Anfänge der Fliegerei gab es in Kiel bereits im Jahr 1908 als die
Gebrüder Steffen aus Kronshagen bei Kiel mit einem Hängegleiter
experimentierten. Im Jahre 1908 fand in Kiel der allererste
Deutsche Flugtag statt. In den folgenden Jahren entwickelten die
Brüder ein eigenes 32 Meter langes Prall-Luftschiff
mit dem Namen Kiel 1
, mit dem sie am 24. März
1910 einen ersten Flug durchführten.
Bald darauf wendeten sie sich jedoch wieder der Entwicklung von
motorbetriebenen Flugzeugen zu. Im Jahre 1910 gründeten sie nicht
nur den Schleswig-Holsteinischen Fliegerklub
(SHFK), sondern auch die erste Flugschule in in Schleswig-Holstein
in Kronshagen, an der auch Offiziere der Kaiserlichen Marine
ausgebildet wurden.
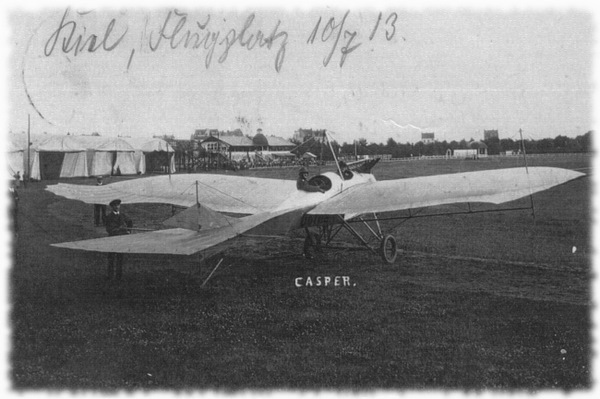 Abb.: Auf dem Nordmarksportplatz
1913. Flugzeug des Typs
Abb.: Auf dem Nordmarksportplatz
1913. Flugzeug des Typs Rumpler Taube
des Fliegers Karl
Caspar. Caspar war Lehrer und Freund des Seefliegers Friedrich Christiansens.
Im Ersten Weltkrieg war Caspar der Erste, der mit einer
Flugmaschine Kleinbomben über England abwarf.1
Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Fliegerei spielte auch der Admiral und Bruder Kaiser Wilhelm I. Prinz Heinrich von Preußen, selbst einer der ersten Flugscheinbesitzer in Deutschland und allen technischen Neuerungen gegenüber sehr aufgeschlossen.
Seit 1913 gab es einen Flugverkehr nach Kiel, wobei zunächst das Nordmarksportfeld als Flugplatz diente. Als dessen Größe nicht mehr ausreichte wurden zwischen 1924 und 1926 die Holtenauer Bauernkaten Dieken, Distelrade und Eekbrook abgerissen, die Reste des Fort Holtenau abgetragen und das ganze hügelige Gelände planiert, so daß ein Flughafengelände von 90 Hektar entstand.
 Abb.: Einweihung des Landflugplatzes im
Juni 1928.
Abb.: Einweihung des Landflugplatzes im
Juni 1928.
Mit dem Ende der militärischen Nutzung des Flugplatzes und der Eingemeindung Holtenaus im Jahr 1922 begann sich die Stadt Kiel für die zivile Nutzung des Geländes zu interessieren, so sollte das Gelände des Voßbrooks zur Industrieansiedlung genutzt werden. Also versuchte die Stadt das Gelände des Seeflughafens und sein Hinterland zu erwerben. Schließlich einigte man sich zwischen Stadt und Marine darauf Flächen zu tauschen. Das Gelände der ehemaligen Quarantäneanstalt ging an die Marine und das Hinterland des Seeflughafens plus einer Parzelle bei Seekamp an die Stadt.
Für die Stadt Kiel war der Erwerb von Uferflächen enorm wichtig, denn große Teile des Fördeufers befanden sich im Besitz der Marine,so daß es kaum Möglichkeiten gab, neue Hafenanlagen zu bauen. Daher sollte Stegelhörn als Hafen ausgebaut werden und auf dem Gebiet des Voßbrook Fein- und Veredelungsbetriebe angesiedelt werden.
Da der Bedarf für einen Landflughafen immer größer wurde, begann man 1925 mit der Einebnung des Geländes des ehemaligen Fort Holtenau, wobei 385.000 Kubikmeter Boden bewegt werden mußten. Weiterhin wurden neue Gebäude und Hallen errichtet. Der neue Zivilflughafen sollte der Stadt Kiel vor allem Flugverbindungen nach Hamburg, Flensburg und Westerland verschaffen.
 Abb.: Das 1930 errichte
Empfangsgebäude des Flughafens.
Abb.: Das 1930 errichte
Empfangsgebäude des Flughafens.
1927 wurde die Kieler Flughafengesellschaft
(KFG) gegründet und ein halbes Jahr später der reguläre
Flugbetrieb eröffnet. Bis 1939 befand sich das Empfangsgebäude des
Flughafens an der Herwarthstraße.
Im Gefolge der Weltwirtschaftskrise mußten die Pläne der Stadt
Kiel zur Industrieansiedlung im Kieler Norden, d. h. im Holtenauer
Voßbrook, aufgegeben werden und der
Landflugplatz wurde im Jahre 1929 wieder an die Marine verkauft,
die jedoch weiterhin einen zivilen Flugverkehr zuließ. Die
paramilitärische Tarnorganisation SEVERA
wurde noch im selben Jahr aufgelöst und das Personal und Material
ging auf die Deutsche Luft Hansa Abteilung Küstenflug
über.
 Abb.:
Piloten der SEVERA in Holtenau.
Abb.:
Piloten der SEVERA in Holtenau.
Im Jahre 1934 verkaufte die Stadt Kiel zudem alles andere hier
bisher erworbene Gelände wieder an den Staat. Dies hatte
gleichzeitig zur Folge, daß alle direkten Wegeverbindungen
zwischen Holtenau und Schusterkrug
unterbrochen wurden. Das Gebiet bei Stegelhörn
wurde Kasernengelände, der Stegelhörner Hafen wurde in Plüschowhafen
(siehe Gunther Plüschow)
umbenannt. In den Jahren 1934 bis 1938 wurde der zivile Flughafen
zum Militärflugplatz ausgebaut.
 Abb.: Ernst Udet (links) auf dem Flugplatz Holtenau,
wahrscheinlich auf dem
Abb.: Ernst Udet (links) auf dem Flugplatz Holtenau,
wahrscheinlich auf dem Großflugtag
am 9.6.1929.
Das brachte den Bau neuer Siedlungen für das Militärpersonal und seine Angehörigen und auch die Ansiedlung neuen Gewerbes mit sich. Die politischen Veränderungen hatten auch große Auswirkungen auf das Holtenauer Vereinsleben, die Holtenauer Kirchengemeinde und die Arbeit der Seemannsmission. Ebenso traf es andere Organisationen, die in der Regel über kurz oder lang gleichgeschaltet oder verboten wurden.
In den 30er Jahren wurden in der Grimmstraße Gebäude für
Angehörige des Flugplatzes gebaut, der nicht zuletzt im Rahmen der
Wiederaufrüstung
vergrößert wurde.
Von den 4.200 Einwohnern, die Holtenau im Jahre 1937 hatte,
gehörten damals rund ein Viertel der Luftwaffe an. Der Flugplatz
wurde in den Jahren 1934–38 als Militärflugplatz auf seine heutige
Größe ausgebaut, d. h. das ganze nordwestliche Gebiet bis hin zur
Boelckestraße wurde Flughafengelände und damit waren alle direkten
Straßenverbindungen zwischen Schusterkrug
und Holtenau aufgehoben.
Das betraf unter anderen den so genannten Schwarzen Weg
,
der vom Eekbrook bis zur Schule Schusterkrug führte. Dafür wurde
eine Straße vom Schusterkrug nach Stift geführt, so daß die
westliche Umgebung des Flugplatzes der einzige Weg zwischen
Holtenau und Friedrichsort wurde.
Die Holtenauer Bauern mußten für
diesen Ausbau große Landflächen verkaufen und der bäuerliche
Charakter Holtenaus begann zu verblassen.
 Abb.:
Lufthansaflug in den 1930er Jahren in Holtenau.
Abb.:
Lufthansaflug in den 1930er Jahren in Holtenau.
Bereits seit 1934 starteten von Holtenau aus Flugzeuge der deutschen Abwehr zu Aufklärungsflügen über Polen, getarnt als eine Erprobung von Höhenflügen. Als dem damaligen Reichswehrminister General Werner von Blomberg bei einer Inspektionsreise auf dem Flughafen Holtenau ein solches Spionageflugzeug gezeigt wurde, führte dieses zur Entlassung des damaligen Chefs des militärischen Geheimdienstes Kapitän z. S. Conrad Patzig.
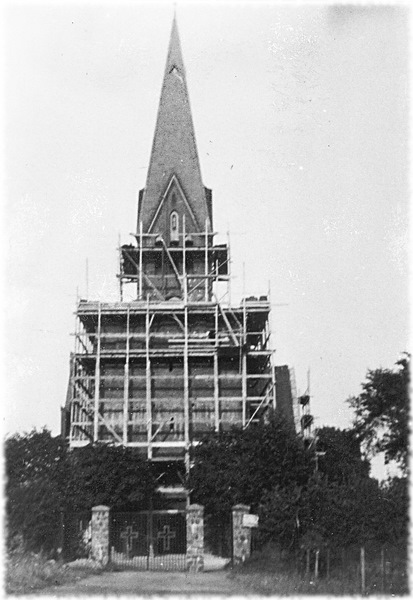 Abb.: Der Umbau der Dankeskirche im Jahr
1935. Der ursprüngliche hohe Kirchturm wurde abgerissen und ein
niedrigerer gedrungener Turm um seinen Stumpf herum gebaut.
Abb.: Der Umbau der Dankeskirche im Jahr
1935. Der ursprüngliche hohe Kirchturm wurde abgerissen und ein
niedrigerer gedrungener Turm um seinen Stumpf herum gebaut.
In Holtenau mußten neue Kasernen, Flugzeughallen und andere militärische Anlagen errichtet werden, dazu kamen Häuser für die Offiziere und Wohnungen für die anderen Wehrmachtsangehörigen. Die Dankeskirche verlor 1935 ihren ursprünglichen Kirchturm und am Ende der Immelmannstraße mußte das Haus Nr. 28 an die Stadt verkauft werden, weil es den Ausbauplänen des Holtenauer Flughafens im Wege stand.
 Abb.:
Auf dem Flugplatz im Mai 1945.
Abb.:
Auf dem Flugplatz im Mai 1945.
Für die Holtenauer hatten Vergrößerung von Flugplatz und
Personalstärke verschiedenste Folgen. Es wurde nicht nur der so
genannte Grimmblock
für die Angehörigen der
Luftwaffe in der Grimmstraße errichtet, sogar ein eigener Luftwaffensportverein
wurde in Holtenau gegründet. Im Stifter Wald wurde das Munitionslager Barkmissen für den
Fliegerhorst angelegt und über eine heute noch teilweise erhaltene
Betonstraße mit diesem verbunden.
 Abb.: Nach Kriegsende starten unter
Aufsicht der Alliierten auf dem Flugplatz noch
Seenotrettungsflugzeuge vom Typ Dornier Do 24.
Abb.: Nach Kriegsende starten unter
Aufsicht der Alliierten auf dem Flugplatz noch
Seenotrettungsflugzeuge vom Typ Dornier Do 24.
Während des Zweiten Weltkrieges waren Flugzeuge aus Holtenau im
wesentlichen an den Operationen gegen Dänemark und Norwegen
beteiligt, z. B. bei Angriffen auf die Norwegische Festung
Oskarsborg. Es wurden auch Versorgungsflüge durchgeführt.
Verschiedene Einheiten wurden aufgestellt und dann an andere
Kriegsschauplätze verlegt.
An Ende des Krieges landeten dann wieder viele Flugzeuge mit
Evakuierten aus dem Osten auf dem Flugplatz. Schließlich wurde der
Flugplatz in den allerletzten Kriegstagen von den Briten besetzt.
Zur selben Zeit landete hier auch die amerikanische Life
-Photografin
Magaret Bourke-White mit nur einem Begleiter auf dem Flugplatz,
worüber sie später in einem Buch Dear Fatherland, Rest
Quietly
.
Im April 1951 genehmigten die Alliierten
wieder den Segelflug in Deutschland und als im Mai 1955 auch der
Motorflugsport erlaubt wurde bekam der Luftsportverein
Kiel
als erster deutscher Verein eine
Ausbildungsgenehmigung. Im Jahr 1955 wurde auch die Bundesmarine
gegründet und bereits im folgenden Jahr wurde Holtenau erneut zum
Seefliegerhorst. Der zerstörte Holtenauer Flughafen wurde 1958
wieder aufgebaut, es wurden neue Kasernen und große Flughallen für
das Militär und die Zivilluftfahrt errichtet.
Bereits Mitte der 50er Jahre gab es Pläne, das Flughafengelände
in westliche Richtung zu erweitern, was jedoch am Widerstand der
Gemeinde Altenholz scheiterte. Bekannt über den Raum Kiel hinaus
wurde der Flugplatz Holtenau auch durch die Rettungseinsätze des Marinefliegergeschwader
5
, kurz MFG 5.
Wie bereits in der Zwischenkriegszeit wurde der Flugplatz sowohl
militärisch als auch zivil genutzt. Im Jahre 1955 wurde auch die Flughafen
Gesellschaft mbH
wiederbelebt und der
Zivilflugbetrieb von Holtenau aus begann erneut.
Die militärische Komponente wurde in den folgenden Jahren immer weiter ausgeweitet und in den folgenden Jahren immer wieder umstrukturiert bzw. umbenannt:
Zum 1.4.1957 wurde die 1. Marinefliegergruppe
in
Kiel-Holtenau gegründet, es folgten in kurzer Zeit weitere
Verbände: Durch den Aufstellungsbefehl Nr. 77 vom 26.2.58 wurde
am 1.4.1958 die 2. Marinefliegergruppe
in
Kiel-Holtenau gebildet.
Aufgrund internationaler Verpflichtungen mußte die Bundesrepublik
ein System zur Rettung auf Land und See (SAR = Search and Rescue)
aufbauen — bis zum Dezember 1967 befand sich in Holtenau auch die
später nach Glücksburg verlegte SAR-Leitstelle. Deshalb wurde
schon acht Monate nach Aufstellung der 1. Marinefliegergruppe eine
eigenständige Seenotstaffel
ins Leben gerufen, deren
Aufbau in Holtenau am 1. Januar 1958 durch Fregattenkapitän
Seebens begann.
Durch den Umgliederungsbefehl Nr.1 vom 13.7.1959 wurde zum
16.07.1959 die 1. Marinefliegergruppe
zum 1.
Marinefliegergeschwader
(MFG 1), die 2.
Marine-fliegergruppe
zum 2.
Marinefliegergeschwader
(MFG 2) und die Marine-Seenotstaffel
in die Marine-Dienst- und Seenotgruppe
umgewandelt. Am 1.10.1961 wurde die Marine-Dienst- und
Seenotgruppe
in das Marine-Dienst- und
Seenotgeschwader
umbenannt. Durch den
Teilaufstellungsbefehl Nr. 119 vom 12.8.1963 wurde in
Kiel-Holtenau eine Hubschrauber-Ujagdstafel mit der Bezeichnung Marinefliegergeschwader
4
(MFG 4) aufgestellt. Schließlich wurde dann am
25.10.1963 das Marine-Dienst- und Seenotgeschwader
in Marinefliegergeschwader 5
(MFG 5)
umbenannt.
Zur Sicherung des Flugplatzes wurde im Juli 1964 dem Geschwader
eine Bodendienstverteidigungsstaffel
unterstellt,
die später in Marinesicherungskompanie
bzw. 1.
Schwere Sicherungskompanie
umbenannt wurde, deren
Hauptaufgabe es im Verteidigungsfall war, Angriffe von Land als
auch aus der Luft abzuwehren. Die Schwere
Sicherungskompanie
wurde Ende 1990 aufgelöst.
Zum 15. August 1956 wurde in Kiel-Holtenau die Marineartillerieversuchsstelle
eingerichtet. Sie unterstand dem Marinewaffenkommando
/ Kommando der Marinewaffen
bzw. der Inspektion
der Marinewaffen
. Zwölf Jahre später wurde wurde sie
dann aber als Teileinheit des Kommandos für Truppenversuche der
Marine nach Eckernförde verlegt. Zu ihren Aufgaben gehörten unter
anderem die Erprobung der Artillerieeinrichtungen von
Marinefahrzeugen nach Indienststellung, die militärische Erprobung
und Begutachtung neuen Artilleriegeräts der Marine als auch die
Mitarbeit an Neuentwicklungen.
Alliierte Seestreitkräfte Ostseezugänge(NAVBALTAP)
Im Januar 1957 wurde die NATO-Dienststelle des Oberbefehlshabers
der Seestreitkräfte der Ostsee
in Kiel auf-gestellt
und schließlich nach einer kurzen Episode in Flensburg-Mürwik im
Jahre 1961 in das deutsch-dänische NATO-Kommando Alliierte
Seestreitkräfte Ostseezugänge
(NAVBALTAP) in Holtenau
überführt, wo es bis zu seiner Verlegung nach Karup in Dänemark im
Jahre 1976 verblieb — geführt abwechselnd von einem deutschen und
einem dänischen Admiral.
Neben dem überregional bekannten MFG 5 waren in Holtenau noch die folgenden Einheiten stationiert:
Stab Marinefliegerdivision(seit 1956),
Stab Amphibische Gruppe(seit 1977),
Geophysikalische Meßzug Ostsee(seit 1957, danach gegründet als ballistischer Wetterzug),
und natürlich seit 1945 das Kiel Training Centre
der Britischen Armee.
…
Im Jahr 1967 wurde der Flugplatz nochmals vergrößert, so daß dessen nördlicher Teil nun der Zivilluftfahrt zur Verfügung gestellt werden konnte während der südliche Teil weiterhin militärisch genutzt wurde. Es wurden der Tower und weitere Gebäude errichtet.
© Bert Morio — Zuletzt geändert: 30-09-2019
Der erste deutsche Flieger, der Bomben vom Flugzeug aus
abwarf, war Gunther
Plüschow, der Flieger von Tsingtau
—
später Kommandant der Seeflugstation Holtenau. ↩